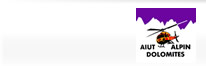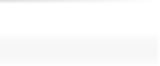Die Sanon Hütte auf der Seiser Alm (siehe Foto) wurde im Jahr 1987 zur Hubschrauberbasis, weil Raffael Kostner, damals Leiter des Bergrettungsdienstes Gröden, während der Sommer und Wintersaison dort verweilte und dort die Notrufzentrale installiert hatte. Erst nach einiger Zeit stellte sich heraus, wie vorteilhaft diese Position für die Rettungseinsätze war, was auch der Orgakom Bericht hervorhob. (Diesem Beispiel folgend wurde vor kurzem auch in der Brentagruppe eine hoch gelegene Hubschrauberstation erstellt, und zwar bei der Malga Zeledria, oberhalb Campo Carlo Magno.) Raffael tat das Möglichste, um sie bestens auszustatten und stellte auch ein medizinisches Depot, ein Lokal für die Rettungsgeräte und die Anlage für die Treibstoffversorgung zur Verfügung. Die Mannschaft wurde in seiner Gasthütte, die manchmal auch als Unterkunft diente, verpflegt.

Nach der Integrierung in die Landesflugrettung wurden einige weitere Verbesserungen notwendig, um die sanitäre Genehmigung zu erhalten. Eine Kehrseite dieser Stationierung, die aber keinen Einfluss auf die Funktion des Rettungswesens hatte, war die Notwendigkeit, gewisse Wartungsarbeiten außerhalb vornehmen zu müssen, und zwar in einer Werkstätte in Trient oder beim Air Service Center in Pavia. Ein Versuch, auf der Seiser Alm einen kleinen unterirdischen Hangar zu bauen, erhielt nicht die notwendigen Genehmigungen.
Die Gelegenheit, eine passende Unterbringung für einen Hangar zu finden, bot sich 1999: In Pontives, Gemeinde Lajen aber nahe St. Ulrich, stand ein geeignetes Grundstück zum Verkauf. Das Objekt lag in der Industriezone und war gut an das Straßennetz angebunden, also ideal für eine Hubschrauberbasis. Eine Helikopter betreibende Firma hatte sich bereits auf dem Nachbargrund eingerichtet, so dass bei den Betriebskosten erhebliche Einsparungen möglich waren. Durch Vermittlung von Raffael Kostner kam es schließlich auch zum Ankauf des Grundstückes.
Nun musste man ein passendes Projekt ausarbeiten lassen und an die Finanzierung denken. Auf der Suche nach vergleichbaren Hubschrauberstandorten organisierte Raffael eine Besichtigungsfahrt nach Landeck in Österreich, wo man eine ähnliche Basis, fernab von Krankenhäusern, gebaut hatte. Dort wurde eine periphere Lage gewählt, weil nur ein Teil der Rettungseinsätze einen direkten Transport ins Krankenhaus erforderte. Die Kosten für diese Struktur, auf öffentlichem Boden und fern von Wohngebieten, beliefen sich auf etwa 2 Mrd. Lire. Neben Raffael Kostner nahmen an dieser Reise auch der Landesrat für Gesundheitswesen in Südtirol, Dr. Otto Saurer, der Vizepräsident der Region, Roland Atz, der Bürgermeister von Lajen, der Vizebürgermeister von St. Ulrich und der Pilot Marco Kostner teil. Dr. Saurer war mit der Möglichkeit, auch in Südtirol eine dezentralisierte Basis zu erstellen, einverstanden und versprach bei der Finanzierung mitzuhelfen.
Es wurde ein Vorprojekt erarbeitet, dem nachträglich eine Dachplattform für nächtliche Landungen hinzugefügt wurde. Bei den Ausgrabarbeiten für die Fundamente war viel Aushubmaterial abzutransportieren, besonders wegen der notwendigen Stabilisierungsarbeiten der steilen Seitenböschung. Im Vergleich zu Landeck fielen auch höhere Kosten für den Grundkauf an, sowie für die Erstellungen von Räumlichkeiten für die Mannschaft.
Dank der Landeshilfe konnte mit den Arbeiten bald begonnen werden, so dass mit einer Inbetriebnahme für den Herbst 2002 gerechnet wurde, was sich allerdings als zu optimistisch erwies. Zur Abdeckung der höheren Kosten trugen auch die Beiträge der Region Trentino Südtirol bei, die durch deren Vizepräsidenten Roland Atz und durch Gino Fontana, Assessor in der Region und Bergrettungsmann des Fassatales, zugesichert wurden. Der Rest wurde mittels Eigenfinanzierung sowie über Gönner und Sponsoren gedeckt.
In den Fundamenten des Baues wurde eine geräumige Garage vorgesehen, die angesichts der knappen Parkmöglichkeiten in der Umgebung sehr wichtig war. Im Tiefgeschoss gelang es, neben Keller und Heizraum einige kleine Zimmer für gelegentliche Übernachtungen von Technikern und Rettern vorzusehen. Das Erdgeschoss besteht aus einem geräumigen Hangar für den Hubschrauber, der im Notfall auch das Einstellen von zwei Maschinen zulässt. Im Freiraum unter den Rotorblättern wurden einige Diensträume für medizinische Ausrüstung und Rettungsgeräte, sowie eine kleine mechanische Werkstatt und ein Lagerraum untergebracht. In einem vorstehenden Teil des Gebäudes wurde die Funkzentrale eingerichtet, mit großen Fenstern für die Überwachung des Flugverkehrs. Im gleichen Stockwerk befinden sich auch Toiletten, sowie der Zugang zum Aufzug. Der erste Stock wurde für den Aufenthalt der Besatzung ausgelegt. Es gibt einen Ruheraum, ein Büro mit Versammlungsraum, eine Wohnung mit Küche für den Hausmeister, die eventuell auch von der Mannschaft benutzt wer- den kann. Der diensthabende Arzt, für den es immer ein Problem war, während der Saison eine Unterkunft zu finden, kann jetzt über eine kleine Wohnung verfügen. Die Plattform Y auf dem Dach ist beleuchtet und für den Nachtflug genehmigt; sie ist für alle Rettungsflugzeuge des Landes ausgelegt, die Tragfähigkeit reicht aber auch für die schweren Maschinen der staatlichen Hilfsdienste.
Die Basis ist im jetzigen Baustand noch nicht beendet. Der Anflug des Hubschraubers zur erhöhten Plattform ist sicherlich optimal, der Bodenlandeplatz muss jedoch, auch in Hinblick auf den Einsatz größerer Hubschrauber, noch vergrößert werden. Wenn der nächtliche Transport von Patienten über die Dachplattform in Betrieb sein wird, muss ein direkter Zugang über einen hydraulischen Aufzug vorgesehen werden. Diese Struktur könnte in Zukunft sehr wichtig für Notfälle und für den Zivilschutz des gesamten Gebietes werden, sowie natürlich für den nächtlichen Rettungsdienst, wie er in der Schweiz bereits routinemäßig praktiziert wird.
|