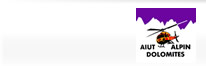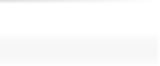| Die Bergrettung begann mit dem Einsetzen des Alpinismus, der in den Dolomiten in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Der erste Rettungseinsatz in Gröden, von dem man verlässliche Dokumente besitzt, fand im Jahr 1898 in der Langkofelgruppe statt. Der damals bekannte englische Alpinist Norman Neruda war in den Schmittkaminen der Fünffingerspitze abgestürzt und hatte sich schwer verletzt. Seine Bergung stellte die beiden Grödner Bergführer Fistil und Pescosta auf eine harte Bewährungsprobe.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und besonders nach dem Ersten Weltkrieg waren die Bergunfälle zahlreich. In dieser Zeit waren es noch in erster Linie die Bergführer, die Hilfe leisten mussten; von ihren Einsatztechniken sind unzählige Anekdoten und Erzählungen überliefert. Ferdinand Glück, einer der aktivsten Bergführer jener Jahre in Wolkenstein, pflegte zu sagen, er habe gut 76 Personen "lebend oder tot" vom Berg herabgetragen.

In den fünfziger Jahren setzte sich der Alpinismus in den Dolomiten endgültig durch und wandelte sich von der Tätigkeit einer Elite zu einem Massenphänomen. In gleichem Maße stieg auch die Zahl der Bergunfälle an, so dass die wenigen aktiven Bergführer nicht mehr in der Lage waren, mit der Bergung der Verunglückten Schritt zu halten. Bald begriffen die jungen Bergsteiger der Dolomitentäler, dass es auch ihre Pflicht war, helfend einzugreifen und sich dementsprechend auszurüsten. Dem Beispiel einiger Städte in der Region und dem nahen Fassatal folgend, wurde im Jahr 1954 der Bergrettungsdienst Gröden gegründet, der sich sowohl dem Club Alpino Italiano, als auch dem Alpenverein Südtirol anschloss. In den Folgejahren entstanden in den Dolomiten und in anderen Tälern der Provinz viele ähnliche Mannschaften.
Fast gleichzeitig mit der Bergrettung formte sich in Gröden die Klettergilde der Catores. Viele von ihnen entwickelten sich zu Bergsteigern von außergewöhnlichem Niveau, die zahlreiche Unternehmungen im höchsten Schwierigkeitsgrad verzeichnen konnten, unter anderem in den Dolomiten, in den Westalpen, im Himalaja und in Südamerika. Die Catores waren es, die Rettungsaktionen organisierten und leiteten. Diese kameradschaftliche Verbindung trug wesentlich dazu bei, dass die Grödner Bergrettung, gemeinsam mit jener des Fassatales, zu der bekanntesten des ganzen Dolomitengebietes wurde.

Ursprünglich erfolgte die Bergung der Verunglückten behelfsmäßig mit der normalen Kletterausrüstung, also mit Seilen, Haken und Karabinern. In den fünfziger Jahren standen neuartige Ausrüstungen zur Verfügung, die eigens für Einsatztechnik in großen Felswänden entwickelt worden waren. Die wichtigste Neuerung war die Anwendung von dünnen Stahlseilen, die auf Hunderte von Metern zusammengekuppelt werden konnten. Somit war ein Abseilen über ganze Dolomitenwände möglich und es konnten Bergungen durchgeführt werden, die man vorher für nicht durchführbar gehalten hatte. Diese neuen Methoden erforderten den Einsatz mehrerer Bergsteiger und eine gut ausgebildete Mannschaft, was zu einem besseren Zusammenhalt und größerem Solidaritätsgeist innerhalb der Gruppe führte. Dieser Gemeinschaftssinn und der Wunsch, immer besser zu helfen, führten letztlich auch zum Einsatz des Hubschraubers und zur Gründung des Aiut Alpin Dolomites. |